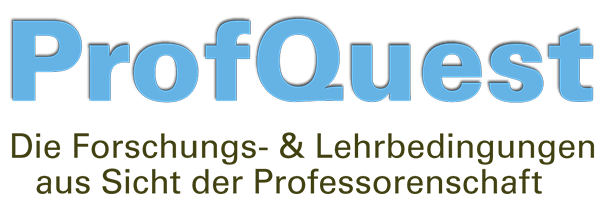IHF kompakt erschienen
Bereit für die Arbeitswelt von morgen? KI in Studium und Beruf aus der Perspektive von Hochschulabsolventinnen und -absolventen
Wie gut sind Studierende auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Berufsleben vorbereitet, untersucht eine aktuelle Ausgabe von IHF kompakt von Moritz Beyer und Susanne Falk. Auf Basis der Bayerischen Absolventenstudie (BAS) zeigen die Autoren, dass der Einsatz von KI in akademischen Berufen stark an Bedeutung gewinnt: Rund die Hälfte der Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 2022/2023 plant, KI regelmäßig im Berufsalltag einzusetzen. Besonders hoch ist diese Nutzungsabsicht bei Absolventinnen und Absolventen aus MINT-Fächern, allen voran der Informatik. Gleichzeitig fällt die rückblickende Bewertung der hochschulischen Vorbereitung auf den KI-Einsatz bei einem der ersten Absolventenjahrgänge, die im Studium mit KI in Berührung kamen, mit insgesamt 14 Prozent (noch) vergleichsweise niedrig aus. Entsprechend groß ist der wahrgenommene Unterstützungsbedarf: Eine Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen wünscht sich im Studium mehr Angebote zum grundlegenden Umgang mit KI, zu praxisnahen Anwendungen sowie zu rechtlichen und ethischen Fragen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass gezielte Angebote im Studium zur Stärkung der Anwendung und des Umgangs mit KI notwendig sind, um die Hochschulausbildung an veränderte Kompetenzbedarfe anzupassen und damit die Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventinnen und -absolventen nachhaltig zu sichern.
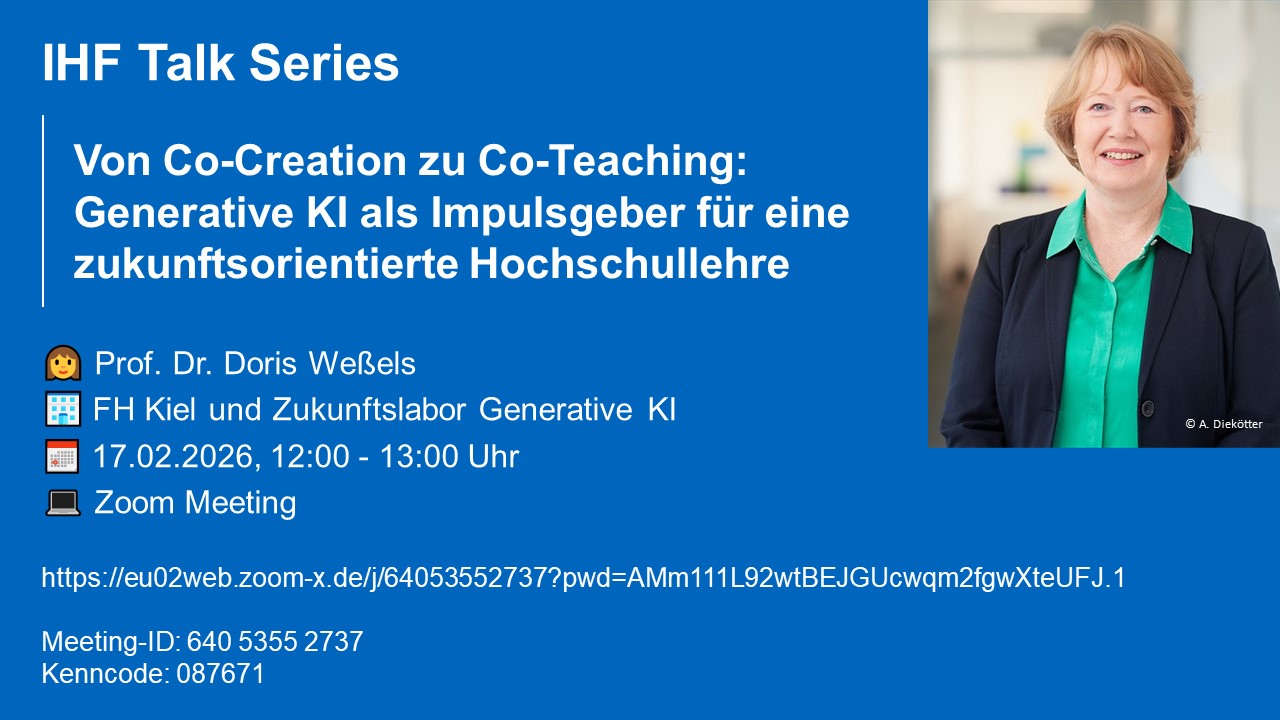
17.02.2026, 12:00 bis 13:00 Uhr, IHF Talk Series "KI in der Hochschule"
Von Co-Creation zu Co-Teaching: Generative KI als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte Hochschullehre
Prof. Dr. Doris Weßels, FH Kiel und Zukunftslabor Generative KI
Am 17.02.2026 wird Prof. Dr. Doris Weßels, FH Kiel und Zukunftslabor Generative KI, einen Vortrag halten zum Thema "Von Co-Creation zu Co-Teaching: Generative KI als Impulsgeber für eine zukunftsorientierte Hochschullehre".
Die Veranstaltung findet online von 12.00 bis 13:00 Uhr via Zoom statt:
https://eu02web.zoom-x.de/j/64053552737?pwd=AMm111L92wtBEJGUcwqm2fgwXteUFJ.1
Meeting-ID: 640 5355 2737
Kenncode: 087671
Abstract
Der Vortrag erläutert den aktuellen Entwicklungsstand generativer KI (insbesondere großer Sprachmodelle und KI-Agenten-Systeme). Darauf aufbauend werden multimodale Einsatzmöglichkeiten in Bildungsprozessen als Formen der Co-Creation vorgestellt und Implikationen für Lehren, Lernen und Prüfen auf Basis aktueller Erfahrungsberichte und Studien aufgezeigt. Abschließend rückt der Vortrag das Co-Teaching von Mensch und Maschine in den Fokus und thematisiert hierfür erforderliche Kompetenzen wie Teacher Agency und AI Leadership mit ihrer Relevanz für eine zukunftsorientierte Hochschullehre.
Sie sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Beiträge zur Hochschulforschung erschienen
Beiträge zur Hochschulforschung - Ausgabe 1/2024
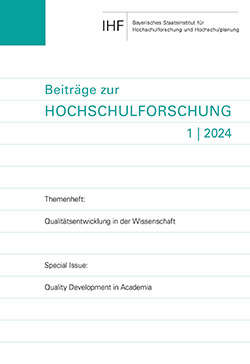
Das aktuelle Themenheft Qualitätsentwicklung in der Wissenschaft der Fachzeitschrift Beiträge zur Hochschulforschung nimmt die Gelingensbedingungen von Wissenschaft in den Blick. Die Erhöhung der Qualität von Forschung und Lehre ist ein weit verbreitetes Ziel von Hochschulpolitik und Hochschulen – Exzellenz wird angestrebt. Aber welche Bedingungen sind notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? Und welche Exzellenzvorstellungen liegen dem heutigen wissenschaftlichen Handeln zugrunde? Welche Auswirkungen haben institutionelle Rahmenbedingungen und Hochschulpolitik auf das qualitätsbezogene Handeln von Akteurinnen und Akteuren im Hochschulbereich? Diese Fragen werden im vorliegenden Heft aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Dabei wird sowohl die Qualität von Forschung als auch von Lehre betrachtet.
Stellenausschreibungen
Verwaltung und Finanzen
Das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Verwaltungsangestellten (m/w/d) (E9 TV-L, 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit).
Tagungsbericht
Gemeinsamer Workshop von IHF und BayZiel ein voller Erfolg
Am 4. Juli 2025 trafen sich rund 150 Expertinnen und Experten aus Hochschulen, Politik und Wirtschaft an der Hochschule München, um gemeinsam zu diskutieren, wie mehr Studierende für die Ingenieurwissenschaften an bayerischen HAW/TH gewonnen und erfolgreich durch ihr Studium begleitet werden können.
In anregenden Vorträgen und Workshops standen Themen wie der Übergang von der Schule in die Hochschule, Studienerfolg, Frauenförderung und duale Studienmodelle im Fokus. Die Referierenden, Prof. Dr. Olaf Köller (IPN Kiel), Dr. Ulrich Heublein (DZHW), Prof. Dr. Klaus Kreulich (Hochschule München) und Dr. Melanie Thaler (Bentley InnoMed), gaben wertvolle Impulse aus Wissenschaft und Praxis. Ergänzt wurde das Programm durch eine Postersession, in der innovative Projekte und Best Practices vorgestellt und diskutiert wurden.
Dr. Thorsten Lenz und Dr. Susanne Falk stellten Ergebnisse einer Abfrage des Bayerischen Wissenschaftsministeriums vor und zeigten dabei, dass die Hochschulen bereits auf sinkende Studierendenzahlen in einigen ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen mit interdisziplinären und englischsprachigen Studiengängen reagiert haben. Zudem wurden neue Studiengänge in den Bereichen KI und Nachhaltigkeit geschaffen sowie Curricula angepasst.
Im Herbst planen die Veranstalter die Veröffentlichung eines Policy Papers mit den wichtigsten Ergebnissen des Workshops.
Wir danken allen Beteiligten für den lebendigen Austausch und den wertvollen Input.
Mehr darüber lesen Sie hier.

Veröffentlichung
Generative KI in der Hochschulverwaltung: Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Projekts GenAI der TUM School of Management
Ein Pilotprojekt an der TUM School of Management der Technischen Universität München (TUM) unter der Leitung von Barbara Tasch beschäftigt sich seit November 2023 mit der Frage, wie generative KI in der Studierendenberatung und für verschiedene administrative Aufgaben eingesetzt werden kann. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) wissenschaftlich begleitet.
Erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitstudie sind jetzt in der Deutschen Universitätszeitung Wissenschaft und Management (Ausgabe 4/2025) erschienen. Dr. Susanne Falk und Barbara Tasch, Managing Director der TUM School of Management, zeigen, dass der Einsatz generativer KI nicht nur die Qualität der Arbeitsleistung verbessert, sondern auch dazu beiträgt, die Arbeitsaufgaben effizienter zu erledigen. Konkret wird an zwei Beispielen - der Erstellung einer Curriculum Map und der Planung einer Veranstaltung - aufgezeigt, wie Mitarbeitende generative KI im School Office einsetzen.
Den Artikel finden Sie hier.
IHF kompakt erschienen
Generative KI als Lernrevolution: Wie Studierende ChatGPT & Co. flächendeckend für Studium und Prüfungsvorbereitung nutzen
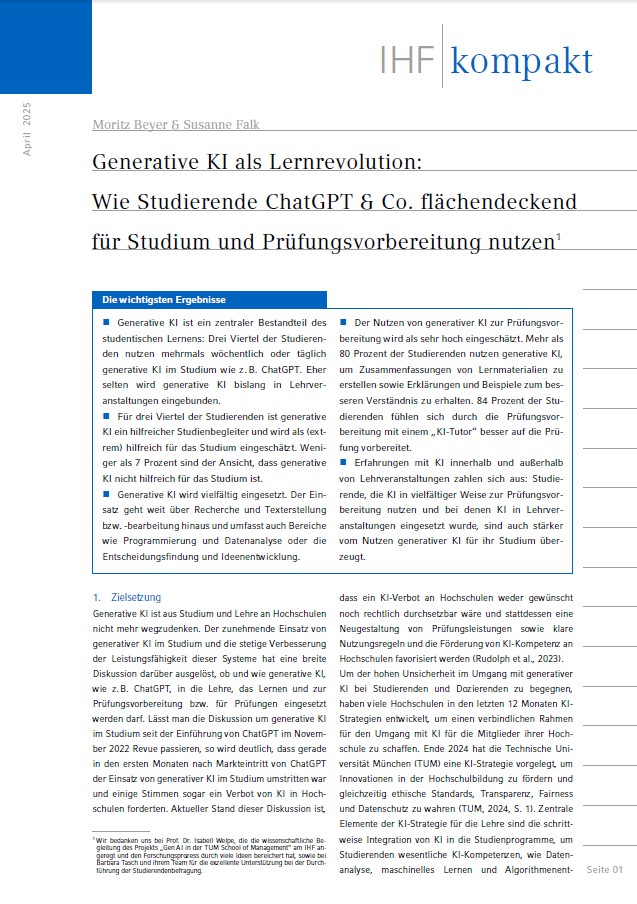
Wie generative KI im Studium und insbesondere bei der Prüfungsvorbereitung eingesetzt wird, ist Thema einer neuen Ausgabe von IHF-Kompakt. Moritz Beyer und Susanne Falk zeigen auf Basis einer Studierendenbefragung an der TUM School of Management, dass generative KI, wie z.B. ChatGPT, von drei Viertel der Studierenden mehrmals wöchentlich oder täglich genutzt wird. Für drei Viertel der Studierenden ist generative KI eine hilfreiche Unterstützung im Studium. Auch der Nutzen von generativer KI für die Prüfungsvorbereitung wird als sehr hoch eingeschätzt. 84 Prozent der befragten Studierenden fühlen sich durch die Prüfungsvorbereitung mit einem „KI-Tutor“ besser auf die Prüfung vorbereitet. In Lehrveranstaltungen wird KI dagegen bislang selten eingesetzt.
Veröffentlichung
Hohe Annahme und dynamische Entwicklung der Tenure-Track-Professur in Deutschland
Der jüngst veröffentlichte Bundesbericht „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase“ (BuWiK) analysiert die Karrierewege, Beschäftigungsbedingungen und Perspektiven von Wissenschaftler*innen in Deutschland. Eine Begleitstudie des Deutschen Zentrums für
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) und des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF) ergänzt die Untersuchung mit Erkenntnissen zur neuen Karriereoption der Tenure-Track-Professur (TTP). Die Ergebnisse zeigen, dass die TTP von
Bundesländern, Hochschulen und jungen Wissenschaftler*innen positiv aufgenommen wird. Bereits über 40 Prozent der Juniorprofessuren in Deutschland – das sind gut 1300 Stellen – sind als TTP ausgestaltet und bieten nach erfolgreicher Bewährung eine dauerhafte Perspektive.
Zur Pressemitteilung gelangen Sie hier.

Neuer Verteiler zu aktuellen Themen und Veranstaltungen des IHF
Neuer Verteiler für aktuelle Veranstaltungen und Workshops des IHF
Gerne informieren wir Sie über aktuelle Themen und Veranstaltungen des IHF. Bitte registrieren Sie sich dazu über folgenden QR-Code oder über diesen Link.